Vatertag
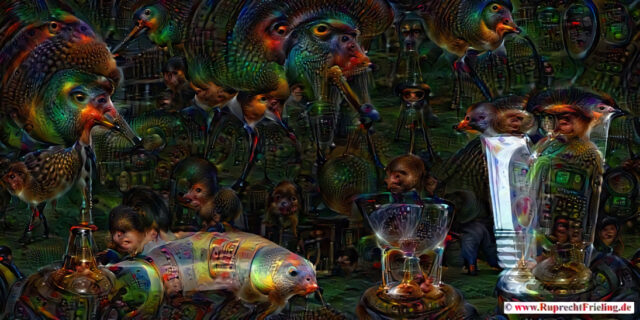
Vatertag
Der Vater lässt sich heut´ nicht lumpen
Besorgt sich Schnaps, Likör und Wein
Es fließt das Bier, es kreist der Humpen
Schüttet auch Weizen in sich rein.
Doch plötzlich hallt ein Donnerknall
Der trunkne Vater kommt zu Fall
Er stürzt zu Boden wie ein Stein
Es zuckt kein Arm mehr und kein Bein.
Die Mutter jammert Weh! und Ach!
Die Kinder werden auch noch wach
Es schreit die Katze, bellt der Hund
Doch Vater wird nicht mehr gesund.
Es rüttelt die Familienschar
Am Vater, der liegt stumm und starr
Maustot am Boden, welch ein Graus
Der Vatertag ist damit aus.
Und die Moral von dem Gedicht?
Erfahr´ des Himmels Strafgericht:
Wer zu viel säuft vom Spiritus,
der spielt mit frühem Exitus.
©Wilhelm Ruprecht Frieling
Chaos, Karma, Katastrophen

Langsam werde ich sauer. Schon wieder ist ein Tag zu Ende gegangen, für den mit tausendprozentiger Gewissheit der Weltuntergang vorausberechnet worden war.
Ich erwache wie an jedem beliebigen Morgen, und überhaupt nichts Weltbewegendes ist passiert. Jetzt muss ich zu allem Übel doch noch Staub saugen und den Müll entsorgen, was ich angesichts des nahenden Untergangs für entbehrlich gehalten hatte. Allmählich beginnen mich diese unerfüllten Untergangsszenarien zu langweilen.
Dabei bin ich als gelernter Katastrophen-Bär der optimale Kandidat für derartige Prophezeiungen
H I E R geht es weiter: http://www.kolumnen.de/kolumnen/frieling/frieling-220511.html
re:publica 2011: ein kritisches Fazit
 Draußen gibt es wenigstens Netz: Teilnehmer der re : publica vor dem Berliner Friedrichstadtpalast. © Foto: W.R. Frieling
Draußen gibt es wenigstens Netz: Teilnehmer der re : publica vor dem Berliner Friedrichstadtpalast. © Foto: W.R. Frieling
Wer bin ich? Woher komme ich? Wo gehen wir heute Abend saufen? Dies waren drei entscheidende Fragen, die sich viele der Teilnehmer der inzwischen fünften Berliner re : publica (13. bis 15. April 2011) stellten.
Rund 3.000 Internetfreaks trafen sich in Berlin, um zum stolzen Eintrittspreis eines Rolling-Stones-Konzerts Teil der re : publica-Welt zu werden. Sie bekamen ein schwarzes Bändchen samt Namensschild um den Hals gehängt, mit dem sie im Friedrichstadtpalast, im Quatsch-Comedy-Club und in der benachbarten Kalkscheune herumstreunen und mehr oder weniger kompetenten Referenten lauschen durften, die ihnen Aspekte des digitalen Lebens nahe bringen wollten.
Sie erlebten dort unter anderem den Auftritt von mittelmäßigen Rednern, deren Beiträge häufig in eine Selbstdarstellung, eine Produktpräsentation oder eine Verkaufsveranstaltung mündeten. Wirklich Neues oder gar Innovatives gab es zwischen den vielen äääh, emmm und öööh kaum.
Die Veranstalter vollbrachten zugleich die Meisterleistung, Themen, die das Publikum wirklich interessierten, in kleinen Räumen zu verstecken. Davor stauten sich bereits lange vor Beginn hunderte Interessierte, von denen nur ein Bruchteil eingelassen werden konnte. Kein Wunder, dass auf Twitter die Mittagspausen als kreativster und angenehmster Teil der Veranstaltung bezeichnet wurden.
In ihrer fünften Wiederholung gerierte die Veranstaltung damit zum Happening der Grüßonkel, nerdisch Meet-and-greet-people genannt. Wer seine Twitter-, Facebook- oder Blog-Freunde einmal persönlich treffen oder auch nur aus der Ferne beäugen wollte, kam voll auf seine Kosten.
Das Publikum wurde von den Organisatoren hinsichtlich des Niveaus und der Erwartungen jedoch unterschätzt. Johnny Häusler, einer der Gründerväter, schaute fassungslos ins Publikum, als seine Frage, ob die Veranstaltung gefalle, mit zahlreichen nach unten gerichteten Daumen beantwortet wurde. Während er noch vermutete, diese Kritik richte sich an die technischen Rahmenbedingungen (das zeitweise funktionierende WLAN war nicht ansatzweise in der Lage, dem Netzverkehr gerecht zu werden, und mitunter brach sogar das gesamte Telefonnetz zusammen), sprach eine Schweizer Teilnehmerin vielen aus dem Herzen, als sie erklärte, ihre Unzufriedenheit sei inhaltlicher Art, sie habe sehr viel mehr erwartet.
Entsprechend kritisiert wurde in auswertenden Kommentaren und Berichten auch die groß angekündigte Gründung des Vereins Digitale Gesellschaft, dem alle gerne gratis zuarbeiten dürfen, deren elf (geheime) Gründungsmitglieder allerdings keine Neuaufnahmen akzeptieren.
Im Ergebnis: Das Format re : publica scheint verbraucht, denn ihre Geschäftsführer haben ihre Hände überall, nur nicht mehr am Puls der Szene. Das hat auch mit dem durch und durch kommerziellen Charakter der Veranstaltung zu tun, bei der immer wieder der Eindruck aufkommt, dass sich eine Handvoll Netzaktivisten gegenseitig Themen, Aufträge und Tantiemen zuspielen.
Vielleicht sollten die Macher der „Konferenz über Blogs, soziale Medien und die digitale Gesellschaft“ auf das Format Barcamp schauen, dass in vielen Städten in den letzten Jahren wachsende Popularität gefunden hat, und das einer Veranstaltung im Stil universitärer Vorlesungen weit überlegen ist: Themen werden direkt aus der Zuhörerschaft geschöpft, damit kann sofort abgeschätzt werden, wie groß das Teilnehmerinteresse an einem Thema ist, daraus resultierend kann wiederum eine entsprechende Raumgröße gewählt werden. Themen und Fragestellungen sind entsprechend aktuell und spannend, zudem sind Barcamps kostenlos zugänglich und damit frei vom Vorwurf, sich bereichern zu wollen
Weitere kritische Rückblicke als Lektüretipps:
Christian Scholz: old school Klüngelgesellschaft e.V.
Malte Steckmeister: re-trospektive: re-infall re-publica
Torsten Maue: #rp11 Ein Schuß in den Ofen
Dörte Giebel: mein rundblickender rückumschlag
Sebastian Cario: re-publica 2011 Das war nichts!
Simon Zeimke: Re-Publica 2011 ein Re-cap
Gänsehaut: Eric Whitacres Virtual Choir 2.0

2.052 Sängern aus 58 Ländern taten sich über YouTube zusammen, um Eric Whitacres Komposition vorzutragen
Am 8. April 2011 erlebte Eric Whitacres Virtual Choir 2.0 seine glanzvolle Premiere im Internet. Nach Aufrufen und genauen Anleitungen bei YouTube wurden Videos von insgesamt 2.052 Sängern aus 58 Ländern zusammengeschnitten. So entstand ein faszinierendes Musikerlebnis mit Gänsehauteffekt. HIER geht es weiter →
Drei goldene Regeln, um auf YouTube zum Star zu werden
April 07, 2011
 Bloggerin Blaubeerina ist auf YouTube mit einem eigenen Kanal aktiv
Bloggerin Blaubeerina ist auf YouTube mit einem eigenen Kanal aktiv
Bloggerin und Blog.de-Suppoteria-Chefin Blaubeerina ist seit einem guten Jahr auf YouTube aktiv. Ihr Kanal Blaufunk wurde inzwischen von mehr als 900 Fans abonniert, und sie spricht pro Sendung mehr als 3000 Zuschauer an.
Was Blaubeerina dabei richtig macht, und was außerdem noch beachtet werden muss, wenn YouTube auf dem Weg zu einem höheren Bekanntheitsgrad beitragen soll, habe ich hier beschrieben: Wie werde ich ein YouTube-Star? Drei Goldene Regeln (Zum Lesen bitte auf den Link klicken)
Was meint Ihr zum Thema?
Treffen der Giganten: Hannes Wader, Klaus Hoffmann, Reinhard Mey, Herman van Veen & Romy Haag
April 02, 2011
Zu einem Treffen der Giganten der deutschen Liedermacherszene kam es jüngst im Berliner Friedrichstadtpalast. Klaus Hoffmann feierte seinen 60. Geburtstag und neben vielen anderen kamen Hannes Wader, Reinhard Mey, Hermann van Veen, Edith Leerkes und Romy Haag. Ich habe dazu fünf kurze Videos produziert, die ich hier gern vorstelle. HIER geht es weiter →
Lohnt es, Martin Suter zu lesen?
Der deutschsprachige Literaturbetrieb wird unverändert von so genannten »Edelfedern« bestimmt. Sie entscheiden darüber (oder versuchen es zumindest), wer »gute« oder »schlechte« Literatur verfasst. Dabei kann es gelegentlich zu Stellungskriegen zwischen den Kritikern kommen, und bisweilen dreht der Wind sogar. Derzeit geschieht das mit dem bisherigen Werk des Schweizer Autors Martin Suter. HIER geht es weiter →
Der Große Pinkler (Pablo Neruda)
Prinz Rupi spricht das Gedicht »Der Große Pinkler« („El Gran Orinador“) aus dem Spätwerk des chilenischen Dichters und Schriftstellers Pablo Neruda (1904-1973)
In seinem Gemälde „Traum und Wirklichkeit“ aus dem Jahre 1981 hat der niederländische Künstler Jan Bouman den Großen Pinkler verewigt.
Hier im Detail:
Wer Lust auf weitere Lesungen aus dem Prinzenpalast hat, der klickt H I E R
Staatsrechtler: Guttenberg ist ein Betrüger
Februar 26, 2011
Mit klaren Worten charakterisiert der Bayreuther Staatsrechtler Prof. Oliver Lepsius das Plagiat, mit dem Kriegsminister von Guttenberg sich den Doktortitel erschlichen hat.
Meine Meinung: Ein Minister, der nach eigenem Bekunden nicht weiß, was er tut bzw. sich nicht erinnern kann, ist ebenso gefährlich wie der viel zitierte Taliban mit dem Sprengstoffgürtel: Er ist eine wandelnde Bombe. Ein solcher Mann darf keinesfalls weiter an den Schalthebeln der Macht spielen.
* * * * * * *
Die Kunst, in diesem Fall die Augsburger Puppenkiste, hat die Entwicklung schon vor Jahrzehnten vorweggenommen. Zum Entspannen und Lachen deshalb noch das Lied der Blechbüchsenarmee „Guttenberg wird den Hang hinunter gestürzt“
NEUESTE BEITRÄGE
- Ritter von der Rolandnadel – die Schlaraffen erstmals öffentlich
- Wie Angst lenkt – und warum sie ein gefährliches Machtinstrument ist
- Der Uhu – Symbol der Weisheit, Hüter des Geistes, Bruder im Scherz
- Neues Buch von Prinz Rupi – »Chaos, Karma, Katastrophen«
- Der Karajan vom Schillerplatz – eine persönliche Leseempfehlung
- Mama Lauda im Heustadel – Hochzeit im Idyll
- Der lachende Uhu – Ergebnisse des Wettbewerbs
- Sippenhaft 2.0 – Die moralische Verurteilung durch Nähe
- Verlernen wir das Lesen?
- Leipziger Buchmesse 2025: TikTok, Tüll und Tausende Teilnehmer
- Wie man einen alten Ochsen in Gang bringt. Eine Allegorie
- Was ist Erfolg? Oder: Scheitern als kreativer Prozess
- Bleib dir selbst treu!
- Gedicht-Wettbewerb »Der lachende Uhu«
- Buchrevolution 2025: Selfpublishing im Turbomodus – Wie KI den Markt überschwemmt
- Ein Leben für die Kultur: Zum Abschied von Manfred Eichel
- Zyn – die moderne Sucht
- Fesselnde Porträts: Prinz Rupis »Der Karajan vom Schillerplatz«
- Lesekultur im Wandel: Überlebt das Buch?
- Lexika im digitalen Zeitalter: Warum gedrucktes Wissen unersetzlich bleibt
- Die Weisheit des Hofnarren oder: Die Last der Sorgen
- Prinz Rupi liest Groteske von Hermann Harry Schmitz
- Abschied mit Wehmut: Clown-Museum Leipzig schließt
- Abschied von John Mayall: Der Vater des britischen Blues
- Teuflisches Opern-Spektakel: »Der Freischütz« in Bregenz
- Spektakulär: Steampunk Meißen 2024
- Kunst trifft Natur: Prinz Rupis Meisterwerke im Rosengarten Forst
- Schreiben bleibt die schönste Nebensache der Welt …
- Girl from Tokyo – ein Prompt im Vergleich
- Warum wir essen, wie wir essen: Eine Reise in die Vergangenheit
- BoD vs. KDP/Amazon: Über Leistungsversprechen und »Compliance«
- Ein Jahrhundert Franz Kafka: Die zeitlose Relevanz eines literarischen Genies
- Ich habe einen Joint gedreht – was nun? Ein Ratgeber für Kiffer
- Leipzig im WGT-Fieber: Das Festival der Schwarzen Szene
- Die Geschichte vom Zeitvertreib und der verlorenen Stunde
- HILFE: Mein Hund hat AD(H)S!
- Der Nussknacker-Modus
- Für alle Freunde des Western: »Das Grenzerbuch«
- Neuerscheinung: »Die Schöpfung« von Prinz Rupi
- Siegfried Sack † – Der sakrale Bildhauer
- Lutz Görner ist tot. Ein Abschied
- Möhrenmassaker im Osterland
- Leipziger Buchmesse zwischen Tradition und Trend
- Fotograf Jürgen Henschel: Der Mann mit der Leiter
- Prinz Rupi im Jahr des Drachen
- Wenn schwarze Schweine träumen
- Der Mythos von der Unentbehrlichkeit
- Tausche Zement gegen Hemingway
- Unsere Zukunft ist in Gefahr. Prinz Rupi sagt NEIN!
- Prinz Rupi spricht Friedrich Nietzsche: »Vereinsamt«
- KRISENMODUS – Wort des Jahres 2023
- PISA-STUDIE: Brauchen wir überhaupt noch Schulen?
- Leinwand-Lyriker RALPH TURNHEIM rockt den Stummfilm
- CHRISTIAN MORGENSTERN: Die unmögliche Tatsache
- Fünf Lehren über das Geld aus »DER KLEINE PRINZ«
- Dunkel war’s, der Mond schien helle
- Sprachverwirrung Deluxe: Wenn DIKTATSOFTWARE zum Dichter mutiert
- Dampf & Design: Werdau im STEAMPUNK-Fieber
- Literarisches Comeback: „DER BÜCHERPRINZ“ auf der Frankfurter Buchmesse
- JOHN McLAUGHLIN – Legende des Fusion
- BUCHBERLIN 2023 im Bild: Ein Fest für Buchliebhaber
- Oper EUGEN ONEGIN in Barcelona
- CHRIS FARLOWE und Colosseum: Auftritt der alten Meister
- Mit Zahnrad, Zylinder und Magie: STEAMPUNK im sächsischen Freital
- NEW HEALING FESTIVAL: ein Fest der Sinne
- Schönheit hat ihren Preis
- Prinz Rupis »Ring des Nibelungen«: Keine Sekunde Langeweile
- Mampe zeigt 100 KI-BILDER zum Thema Elefanten
- Mit Zahnrad und Zylinder: Meißen taucht in STEAMPUNK ein
- Prinz Rupi lässt bei Mampe 100 ELEFANTEN fliegen
- Hitze, Haut und Humor: Ein morbides Sommerabenteuer
- Prinz Rupi zeigt Steampunk-Kunst in Meißen
- Frisch auf die Ohren: Gratis-Hörbücher vom »Roboter Archimedes«
- John Lennons »Yellow Submarine« jetzt im Lügenmuseum
- »Angriff der Killerkekse«: Sarkasmus und schwarzer Humor treffen auf Alltagssituationen
- »Stress im Cyberspace«: Prinz Rupis sarkastischer Blick auf die digitale Welt
- Interview mit NAPOLEON BONAPARTE: »Die Feder ist mächtiger als das Schwert«
- Patricia Strunk: Anwältin wird Fantasy-Autorin
- PUPSALOT IST DA!
- Ist Text-Ki ein stochastischer Papagei?
- Clemens Brentano: Alliteration als Stilmittel
- Orgelmusik trifft KI-Bildersymphonie
- Uwe Kullnick: »Prinz Rupi ist der kreativste Mensch, den ich persönlich kenne«
- Martin Regenbrecht: Büchermachen ist ein Vergnügen
- Das liebestolle Krokodil – Eine KI-Groteske
- Was ist Künstliche Intelligenz? – Die KI antwortet im Interview
- Helmut Rosenthal – Der Lionel Hampton von Hermsdorf
- Sensationsfund in Sachen OTTO BÖGEHOLZ
- Die Legende vom Schlaraffenland
- Chris Farlowe: Eine lebende Legende des Blues
- Ki für Einsteiger: Der Tanz ums goldene Kalb
- 20 Begegnungen auf der BuchBerlin 2022
- KI fördert Neugier, Spieltrieb und Fantasie
- KI-Kunstgalerie in Schloss Lilllliput rockt
- KI-Kunst: Der Osnabrücker Friedenspanzer
- Premiere im Buchmarkt: Erstmals KI-Kurzkrimi erschienen
- René Magritte – Wegbereiter der KI-Kunst
- Praxisbericht: Prinz Rupi erklärt KI-Kunst
- Prinz Rupi zeigt seine KI-Kompositionen in Schloss Lilllliput
- »ABC der Verlagssprache« neu erschienen
- Internet intern: Darum gewinnen Neuerer
- Bregenz: Premiere von »Madame Butterfly« säuft ab
- Weltberühmt durch Selfpublishing?
- Breaking News: Prinz Rupi angebissen!
- 80 Jahre Hannes Wader
- 70 Jahre Prinz Rupi – Eine Nachbetrachtung
- Unbewusste Kräfte aktiv nutzen
- Wie nutze ich ein Pseudonym richtig? – Alles über Künstler-, Tarn- und Decknamen
- Neue Kinderbuchreihe: Der Roboter Archimedes
- Kunst gegen Krieg und Kanonen
- Autor sucht Verleger: Wie finde ich einen Verlag für mein Buch?
- Wie man erfolgreich E-Books verkauft
- Stilkunde: Alliteration und Tautogramm
- Mit Büchern das gefrorene Meer der Zeit löchern
- Die heißesten Fotos von der BuchBerlin 2021
- Self-Publishing-Day 2021 in Wort und Bild
- Siri hilft beim Wählen. Eine Satire
- Samstagnachmittag zu Hause
- Prinz Rupi besucht Schloss Lilllliput
- 1-Satz-Literaturclub feiert Jubiläum
- Feuchtes Erwachen
- Ich habe ein Buch geschrieben – Was nun?
- Clubhouse: Heisser Scheiss mit Suchtgefahr
- Weihnachtspost im Zeichen der Corona-Pandemie
- Prinz Rupi wagt den Covid-Test
- Bye, Bye, Thomas R. P. Mielke
- Sex ist mies. Beat ist mies. Eine Farce
- Möhren, Mohren, Moritaten
- Pest-Lektüre: Die Maske des Roten Todes von E. A. Poe
- Bye, bye, Phil May!
- Joseph Beuys: Ein Künstler folgt seinem Stern
- Hurra! Es gibt wieder Klopapier!
- „Der Panther“: DAS Gedicht zur Corona-Krise
- Der Große Corona-Maskenball
- Kurzausflug in einer Höllenmaschine
- Passierschein A38 gegen Ausgangssperre
- Sicherheit durch Kaffeefilter gegen Viren?
- Leipzig: Buchmessen-Absage und wirtschaftliche Folgen
- Leipziger Buchmesse 2020 wegen Corona abgesagt
- Kino: PARASITE bietet grandiose Satire
- Gruselig: Wie ein Berliner Miethai Menschen schikaniert
- JOJO RABBIT – Kann man über Hitler lachen?
- Eberhard Kleinschmidt (80), der älteste Slammer Deutschlands
- Die Ursonate des Merzmenschen Kurt Schwitters
- Videopionier Wolf Kahlen wird 80
- ASMR gilt als der neue Gehirn-O(h)rgasmus. Mit Hörbeispielen
- Die Kuh im Propeller: Ritsch – Ratsch! Weg war sie
- Können Männer Romance schreiben?
- BuchBerlin 2019 – der ultimative Bildbericht
- Janina Venn-Rosky: „Milliardärs-Romanzen schreibe ich nicht“
- Psychogramm des Hofnarren
- Hab Sonne im Herzen – auch in schweren Zeiten
- Clash of Cultures oder: It´s a DaDa-World
- Liefert Self-Publishing nur Schrott?
- Liebeserklärung an Hans Fallada
- Von Schundromanen, Zeitfressern und Nicht-Marketing – Interview mit Sarah Baines
- Brunopolik – Scheitern als Teil der Kunstproduktion?
- Der Hase im Rausch
- Wie Axel Hollmann Schriftsteller wurde. Porträt eines Self-Publishers
- Nulla dies sine linea – Über den Schreibzwang
- Wie oft sollte ein Newsletter erscheinen?
- Ein Komma kann Leben retten
- Ahoj-Brausepulver gegen Hitzekoller. Ein Geständnis
- Bregenzer Festspiele 2019: »Rigoletto« am Bodensee
- Wie konzentriere ich mich beim Schreiben?
- Parkbank-Lesung bei Bruthitze: 12 Fotos, die jeder sehen muss
- Jennifer Hilgert: Innehalten!
- Muss ein Autor fließend schreiben können?
- 8. LoveLetterConvention – das ultimative Fest für Fans des Liebesromans
- Self-Publishing-Day 2019 bricht zu neuen Ufern auf
- Berlin-Tiergarten: Literatur auf der Parkbank
- Manfred L.: Ich bin der schreibende Leichenflüsterer
- In welchem Kostüm kommt Lady Gaga zum Self-Publishing-Day 2019?
- Lektorat? – Nein, danke!
- Hanami – Das farbenfrohe Fest der Kirschblüte
- Franz Michael Felder: Der schreibende Bauer
- Auf einen Kaffee mit Elke Becker
- Auf eine Tasse Tee bei Tanja Neise
- Wie ich zum Spinnenmann wurde
- Die Buchkritik ist tot. Lang lebe die Buchkritik!
- Deutschland-Video von Rammstein provoziert
- Lügen, Likes und Liebesschwüre
- Was sind Sterne-Bewertungen bei Büchern heute wert?
- Torsten S., der rasende Lokalreporter
- Susanne Höhne: Galeristin aus Leidenschaft
- Stephan Graf von Bothmer: Stummfilmpianist mit Kultstatus
- Deutschland, mein Wintermärchen
- Mila Vázquez Otero: Kunstwerke aus Papiermaché
- Erich Mühsam: Latente Talente
- Der Fall Relotius und die Autoren
- Crowdfunding für Kunstprojekte: Mit Moos mehr los
- Mehr als 1 Million Besucher auf Prinz Rupis YouTube-Kanal
- Potsdam: 1. Buchmesse der Autoren und Verlage
- BuchBerlin 2018: Treffen der Paradiesvögel
- Der Mond am Baukran im PalaisPopulaire
- Galerie Beuteltier-Art zeigt kubanische Kunst
- Ingo Insterburg: Bis zuletzt den Schalk im Nacken
- Gangsterfilm 4Blocks oder: Wem gehört Berlin?
- Michael Hutter: Ein Hieronymus Bosch der Neuzeit
- Dortmund: Pink Floyd Exhibition rockt
Sämtliche Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Missbrauch wird anwaltlich verfolgt. © Ruprecht Frieling aka Prinz Rupi, Berlin





