Ob Pandemie oder Krieg: Wer Angst sät, kann Menschen leichter steuern. Ein Blick darauf, wie Medien, Politik und Meinungsmacher ein Klima der Furcht erzeugen – und wie wir als Gesellschaft darauf reagieren sollten.
Angst als politisches Werkzeug
Von Prinz Rupi
„Wer Angst hat, gehorcht.“
Kaum ein Satz beschreibt die Dynamik moderner Krisenkommunikation besser. In Pandemie- wie in Kriegszeiten dient Angst nicht nur als Warnsignal, sondern auch als wirksamer Hebel zur Steuerung. Sie senkt Widerspruch, erzeugt Konformität und legitimiert Eingriffe, die unter Normalbedingungen schwer vermittelbar wären.
Die Pandemie: Appell an Urängste
Die reale Gefahr durch das Virus wurde von einer intensiven, teils dramatischen Kommunikation begleitet. Ein internes, „Nur für den Dienstgebrauch“ gekennzeichnetes Strategiepapier des Bundesinnenministeriums empfahl, elementare Urängste – etwa das qualvolle Ersticken – gezielt anzusprechen, um Zustimmung zu harten Maßnahmen zu erhöhen. Angst sollte demnach Teil der Pandemiebekämpfung sein.
Die Folge: ein hoher moralischer Druck. Zweifel wurden schnell als unsolidarisch gedeutet; Kritik geriet in den Verdacht, gefährlich zu sein. So verschiebt sich die Debatte vom Abwägen zur Abgrenzung.
Kriegstüchtigkeit als neue Handlungsmaxime?
Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine setzte sich die Logik fort. Die öffentliche Kommunikation ist von Bedrohungsszenarien und martialischer Sprache geprägt. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach am 27. Februar 2022 im Bundestag von einer „Zeitenwende“ – die Welt sei „danach nicht mehr dieselbe wie davor“. Der Weg war frei für ein historisches Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, getragen von breiter Zustimmung.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius forderte, Deutschland müsse „kriegstüchtig“ werden. Der Begriff ist historisch belastet; eine Gleichsetzung mit Goebbels verbietet sich, aber die gleiche Wortwahl verdeutlicht: Angst und Bedrohungswahrnehmung schaffen Zustimmungsfähigkeit. Passend dazu provozierten Kommentare und Titelgeschichten die Frage, ob „Pazifismus auf den Müllhaufen der Geschichte“ gehöre.
Die Logik der Angst: Steuerung statt Debatte
Angst reduziert Komplexität. Sie teilt die Welt in klare Fronten – „wir“ gegen „die“. Das erleichtert Entscheidungen und erhöht Regierungsfähigkeit, schwächt aber die kritische Öffentlichkeit. Der französische Philosoph Michel Foucault hat beschrieben, wie sich Macht von offener Repression zu subtileren Formen der Disziplinierung verschiebt. Panoptismus bedeutet: Nicht die Gewalt zwingt zur Anpassung, sondern das Bewusstsein ständiger Beobachtbarkeit. Menschen regulieren sich selbst – aus Vorsicht, nicht aus Überzeugung.
Übertragen auf Krisenkommunikation: Wenn moralische Schablonen den Diskurs ersetzen, verstummen abweichende Stimmen. Was als Schutz beginnt, endet leicht in Selbstzensur.
Was hilft? Wachsamkeit statt Panik
Demokratie lebt vom Zweifel, nicht vom Daueralarm. Wer Krisen benennt, muss auch die Kommunikation über Krisen kritisch betrachten dürfen. Hilfreich sind:
Sprache prüfen: Alarmwörter, Endzeitmetaphern, Freund-Feind-Raster erkennen.
Quellen vergleichen: Zahlen, Annahmen und Kontext prüfen – besonders bei Bildern und Grafiken.
Argumente trennen: Fakten, Bewertungen und Maßnahmenbegründungen auseinanderhalten.
Widerspruch zulassen: Kritik ist kein Verrat, sondern demokratische Pflicht.
Maß halten: Proportionalität von Eingriffen regelmäßig neu begründen.
Fazit: Angst ist ein mächtiges Werkzeug – und gerade deshalb gefährlich. Als Journalisten, Bürger und freie Menschen sollten wir wachsam bleiben gegenüber der Macht der Angst und denen, die sie bewusst einsetzen. Wachsamkeit ist kein Alarmismus, sondern die Bedingung einer offenen, selbstbewussten Demokratie.
©Prinz Rupi 2025
Lesen Sie zum Thema:

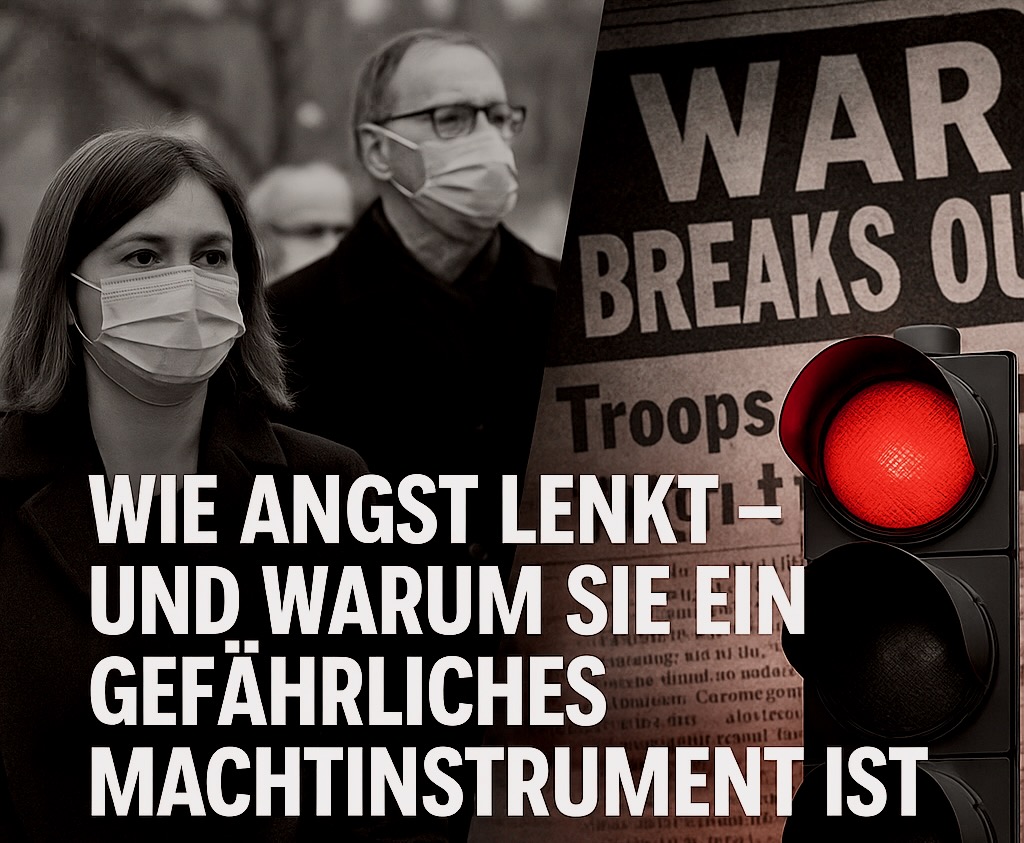

Vielen Dank für den hervorragenden Beitrag, der es auf den Punkt bringt!
Demokratie lebt vom Vergleichen, vom ins Gespräch kommen, vom Perspektivwechsel, vom Regulieren, Sachlichkeit, nicht in Extreme fallen und dem Mut, der Angst mit Ruhe zu begegnen.
Das ist für uns alle anstrengend, weil es nie fertig ist und regelmäßige Arbeit erfordert. Aber nur so bleibt unsere Demokratie und unser Geist (wie auch unser Körper im Sport) fit.
Es ist mir ein wahres Vergnügen ihre Bücher zu entdecken
sowie ihre Blogeinträge zu lesen. E7n herzliches Dankeschön.
Dankeschön!